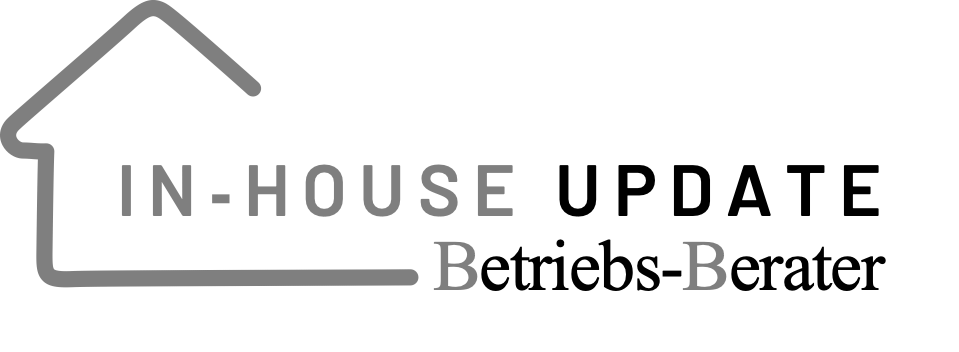Einreisesperre und Klarnamenpflicht: Wenn Identität zur Waffe wird
Als Medienrechtsanwält:in konnte man jüngst zwei in der äußerungsrechtlichen Praxis im Internet voneinander kaum zu trennende, zum Teil sehr beunruhigende, Entwicklungen beobachten.
Auf der einen Seite verhängen die USA durch das U.S. Department of State am 23. 12. 2025 Visa-Restriktionen gegen europäische Akteure – darunter die Geschäftsführung von HateAid – und brandmarken deren wichtige Arbeit im Umfeld europäischer Plattformregulierung als „Zensur“. Gestützt wird die Einreisesperre auf den Vorwurf, dass „diese radikalen Aktivisten und als Waffen eingesetzten NGOs die Zensurmaßnahmen ausländischer Staaten gegen amerikanische Meinungsträger und amerikanische Unternehmen vorangetrieben“ hätten. Ein nicht zu akzeptierender Vorgang, der sich nicht allein mit dem unterschiedlichen Verständnis dieser beiden Rechtskreise von der Meinungsfreiheit und ihrer Einschränkbarkeit erklären, geschweige denn entschuldigen lässt. Vielmehr ist dies Ausdruck der voranschreitenden demokratiezersetzendenden Entwicklungen in den USA.
Auf der anderen Seite flammt in Deutschland die Debatte um eine Klarnamenpflicht im Internet als vermeintlicher Hebel gegen Hass und Hetze wieder auf. Der frühere Präsident des BVerfG Andreas Voßkuhle verwies kürzlich in einem Interview mit dem Tagesspiegel auf eine „Verrohung im Netz“, der er eine gesetzliche Klarnamenpflicht entgegensetzen würde, um „die Diskurskultur etwas zu rationalisieren“.
Beiden Vorgängen ist gemein, dass sie Identitäten zum Dreh- und Angelpunkt machen. Identität ist nicht nur sozialer Kontext und zu schützendes Gut, sondern stets auch ein Machtfaktor. Wer Identität im Netz zwingend offenlegt oder politisch sanktioniert, verändert die Bedingungen, unter denen Persönlichkeitsrechte grenzüberschreitend verteidigt werden können.
Denn Fakt ist, dass die Rechtsdurchsetzung im Äußerungsrecht zum Schutz von Persönlichkeitsrechten aufgrund der nicht zuletzt über § 19 Abs. 2 TDDDG den Dienstanbietern auferlegten, zu gewährenden anonymen Nutzungsmöglichkeit in der Regel über die Plattformbetreiber führt. Ohne Namen kein Täter, keine Rechtsdurchsetzung. Die leidgeprägte Medienrechtler:in weiß jedoch im Umgang mit den Plattformbetreibern zu berichten, dass der vorgerichtliche Hinweis („Notice-and-Takedown“) selbst bei eindeutig benannten Unwahrheiten oder massiven Schmähungen häufig auf automatisierte, juristisch nicht versierte „Empfänger“ bei den Plattformen trifft, mit häufig nicht hinzunehmenden Reaktionszeiten. Die Frustration wird sodann jedoch auf die Spitze getrieben, und die Rechtsdurchsetzung findet ein jähes Ende, wenn nach der über § 21 TDDDG erzwungenen „Kooperation“ der Plattformbetreiber am Ende die Bestandsdaten zu einem weiterhin anonymen Täter führen. Dies in einem Bereich, bei dem es bisweilen um Existenzen geht, jedenfalls aber immer um Schnelligkeit.
Die Sanktionen gegen die Führung von HateAid werden neben den persönlichen Einschränkungen des beruflichen und privaten Wirkkreises durch die ausgesprochene Einreisesperre aber wohl auch zum Verlust ihrer Handlungsmöglichkeit als sog. „Trusted Flagger“ führen. Als ein solcher nach Art. 22 DSA geführter vertrauenswürdiger Hinweisgeber wurden die Meldungen von HateAid in der Vergangenheit von den Plattformen nach den Vorgaben des DSA vorrangig behandelt und einer raschen Entscheidung zugeführt. Ein extrem wichtiges Werkzeug in der praktischen Arbeit solcher Organisationen.
Vor diesem Hintergrund und der berechtigten Sorge, dass amerikanische Unternehmen, Institutionen und Gerichte dem von der US-Regierung erhobenen Vorwurf „Zensur“ folgend, die grenzüberschreitende Rechtsdurchsetzung zukünftig mindestens erschweren werden, erscheint die Klarnamenpflicht wie die eierlegende Wollmilchsau: Wer mit Klarnamen spricht, beleidigt weniger, also die erhoffte Versachlichung der Diskurskultur. Gleichzeitig werden die Plattformen als Nadelöhr aus der Gleichung genommen.
Der mit der gewährten Anonymität bezweckte Schutz der Meinungsfreiheit und mit ihr der Schutz kritischer Meinungen vor politischer Verfolgung ist ebenso evident wie höchstgerichtlich bestätigt. Der Versuch, über eine Klarnamenpflicht Debatten zu „entgiften“, kann den Preis der Teilnahme an der Debatte erhöhen und gerade jene Stimmen verdrängen, die für eine lebendige demokratische Öffentlichkeit erforderlich sind.
Die Lösung mag wie so häufig in der goldenen Mitte liegen. Anonymität ja, aber nicht gegenüber jedem. Es ist nicht die Klarnamenpflicht, welche die Nutzer:innen zu einer angemessenen Diskurskultur anhalten könnte und eine Rechtsdurchsetzung ermöglicht. Es ist vielmehr die „bloße“ Identifizierbarkeit, die ein Verbleiben in der öffentlichen Anonymität weiterhin gestattet, sofern sichergestellt ist, dass verifizierte Bestandsdaten bei den Plattformbetreibern vorhanden sind, die nach entsprechender gerichtlicher Anordnung herausgegeben werden können und auch müssen. Diese Identifizierbarkeit und damit im Falle der Rechtsverletzung herzustellende Verantwortlichkeit muss aber auf der anderen Seite unverzichtbare Voraussetzung für die Teilnahme an einem öffentlichen Diskurs sein. Wie nun allerdings vor den Entwicklungen in den USA diese grenzüberschreitenden Auskunftswege sichergestellt werden sollen, damit Persönlichkeitsrechtsschutz nicht von der politischen Groß-Wetter-Lage abhängt, wird eine Herausforderung der nächsten Zeit bleiben.

RA Robert Golz, LL.M.*
Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und Partner bei HÄRTING Rechtsanwälte. Im Schwerpunkt befasst mit diversen Fragen zum Urheber-, Presse- und Wettbewerbsrecht.